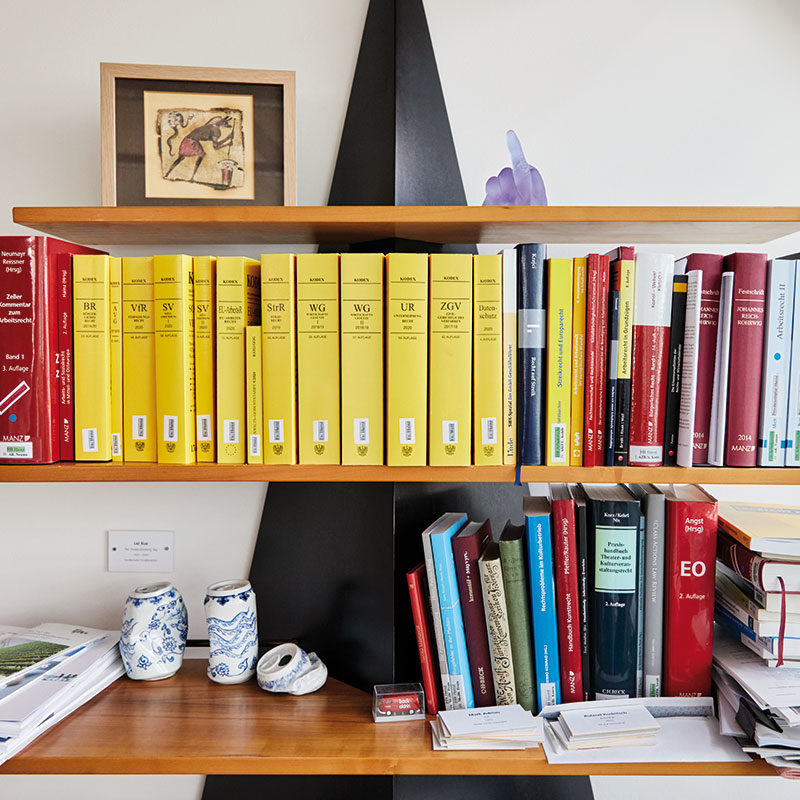Zu Besuch im „Contemporary Museum Schillerplatz“
Der Fall Gurlitt, einer der spektakulärsten Kunstfunde der Nachkriegszeit, sorgte 2013 für mediale Aufmerksamkeit und gab viele rechtliche Rätsel auf. Als Cornelius Gurlitt 2014, zwei Jahre nach der Beschlagnahmung verstarb, ging aus seinem Testament hervor, dass das Kunstmuseum Bern das Konvolut von rund 1500 Werken übernehmen soll. Das Kunstmuseum Bern hat Cornelius Gurlitts Erbschaft angenommen, aber nur jene Werke, bei denen es sich nachweislich nicht um Raubkunst handelt. Dazu hat die Stiftung Kunstmuseum Bern eine Vereinbarung mit der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Bayern getroffen. Arbeits- und Kunstrechtsexperte Dr. Bernhard Hainz hat das Museum im Zuge dieser heiklen Erbschaft mit CMS Österreich, Deutschland und der Schweiz beraten und begleitet. Hainz ist selbst begeisterter Kunstsammler und kann durch seinen persönlichen Zugang und Erfahrungsschatz eine beeindruckende Expertise im Kunstrecht vorweisen. In 25 Jahren Sammlertätigkeit hat er gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth eine bedeutende Sammlung von rund 1000 Kunstwerken aufgebaut.
Besichtigt werden kann diese auf einer Ausstellungsfläche von 3.500 m² im ersten Bezirk in Wien. Es handelt sich dabei um die Räumlichkeiten der Anwaltskanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz. Auf drei Stockwerke verteilt, kann man in den vom Architekten Ernst Mayr konzipierten modernen Räumlichkeiten vielfältige Exponate der zeitgenössischen Kunst entdecken. Der Sammler empfängt uns und meint gleich einleitend scherzhaft, dass „CMS unter kunstaffinen Insidern auch oft als Abkürzung für Contemporary Museum Schillerplatz“ definiert wird. Man spürt sofort, Bernhard Hainz hat einen Sinn für Humor und sammelt definitiv nicht, weil es „en vogue“ ist, sondern aus purer Leidenschaft. Gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth sammelt er seit 1994 – und zwar nicht mit den Ohren, wie Hainz betont, sondern mit den Augen und dem Herzen. Anfangs hat Familie Hainz lange Zeit gegen den Strom figurativ gesammelt und durchaus nicht nur prominente Namen, sondern eben auch gerne Entdeckungen gemacht: „Es geht uns darum, versteckte Juwelen zu heben.“ Im Zuge dessen unterstützt die Familie Hainz auch immer wieder Buchprojekte. „Beispielsweise die Monografie von Karl Stark anlässlich seiner Personale 2002 im Joanneum Graz zu seinem 80sten Geburtstag. Oder die Herausgabe eines Werkverzeichnisses für Leander Kaiser. Oder für Traudel Pichler, die leider 2002 viel zu früh verstorben ist. An dieser Monografie habe ich gemeinsam mit Gunter Damisch, der zuerst ihr Student und später ihr Chef an der Akademie war, gearbeitet. Beim Verlag Hatje Cantz habe ich 2017 ein Buch über den Schweizer Künstler Andreas Straub mit dem Titel „Anleitung zur Sehstörung“ herausgegeben“, erzählt Bernhard Hainz. Aktuell sind wir dabei, ein Werksverzeichnis für Kurt Absolon zu erstellen, das war mir auch schon lange ein Anliegen. Absolon ist ein genialer Grafiker und in eine Linie mit Kubin, Sedlacek oder Brosch zu stellen. Und Zukunftspläne gibt es ebenfalls schon. Gemeinsam mit Ines Lombardi soll eine Monografie für Erwin Thorn entstehen.
Für die Besichtigung der Sammlung benötigt man mindestens 1,5 Stunden – also starten wir gleich mit dem Rundgang. Die Hängung und Stellung der Werke erfolgt nicht wahllos, sondern thematisch. Barbara Hainz, die Tochter des Sammlerpaares, selbst Absolventin der Akademie der bildenden Künste in Wien (Martin Guttmann, Fotografie) und selbstständige Künstlerin, hat mittlerweile auch die kuratorische Begleitung übernommen. Die Werksgruppen sind in den Flügeln und Geschoßen verteilt: abstrakte Malerei und Skulpturen, Grafik auf Papier, Wiener Aktionismus, Expressionismus, figurative Malerei, Fotografie. Jedes einzelne Werk sorgfältig positioniert, im Kontext präsentiert und professionell beschriftet. Derzeit ist auch ein Gesamtkatalog in Ausarbeitung. In den einzelnen Meeting-Räumen, die nach den CMS-Standorten wie Türkei, Bulgarien, Kroatien, Ukraine etc. benannt sind, findet man „site-specific-art“. Künstler*innen aus dem jeweiligen Herkunftsland. Beispielsweise der 1973 geborene David Maljkovi´c, der im kroatischen Raum eine Installation aus Fotografie und blauem Vorhangstoff umgesetzt hat. Die Fotografien zeigen Formen der Kommunikation wie Körpersprache, eine Konferenz, eine Rede – sehr subtil und passend für einen Raum, in dem kommuniziert wird. Im Raum Bulgarien steht ein Modell des Bronzehaus-Projektes des österreichisch-bulgarischen Künstlers Plamen Dejanoff. „Wir fördern spezifische Projekte, die sich manchmal auch aus der Situation heraus ergeben, wie beispielsweise dieses Bronzehaus Projekt mit Plamen Dejanoff in Sofia anlässlich der EU-Präsidentschaft beider Länder im Jahr 2018“, erzählt Hainz. Als die bulgarische Armee im August 1999, zehn Jahre nach der Wende, das Mausoleum in die Luft sprengte, scheiterte sie. Das Gebäude knickte ein wenig ein, aber hielt dem Angriff der neuen demokratischen Zeit stand. Erst im zweiten Anlauf brach es zusammen und wurde abgetragen. Dimitrow war bereits 1990 auf dem Zentralfriedhof in Sofia beigesetzt worden. Vier Jahrzehnte lang marschierten Schulklassen und sozialistische Funktionäre an seinem einbalsamierten Leichnam im Mausoleum vorbei. Danach blieb der Platz jahrelang leer, weil sich die politischen Fraktionen in Bulgarien nicht auf ein mehrheitsfähiges Projekt einigen konnten. Bis man sich auf das Bronzehaus-Projekt einigte. Dejanoffs „Bronzehaus” stand für ein Jahr über dem riesigen Keller des einstigen Grabmals. „Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als der Kunst diese vermittelnde Funktion im öffentlichen Raum auf einem derartig politisch kontaminierten Platz zu überlassen. Ein großartiges Referenzprojekt für die Kunst“, schwärmt der Sammler.

Der Galerist Georg Kargl war ein langjähriger Freund und Begleiter der Sammlung Hainz. Aber begonnen hat die Leidenschaft schon früher. „Ein wunderschönes Blatt von Rudolf von Alt und eine Kaltnadelradierung von Mirò waren die ersten Werke, die wir uns angeschafft haben“, so Hainz, und fährt fort: „Durch Rudolf von Alt ist eigentlich auch die Leidenschaft zum Kunstsammeln entstanden, und zwar für die Kunst des 19. Jahrhunderts, Stimmungsimpressionismus. Dann haben wir uns relativ rasch Richtung Expressionismus und Klassische Moderne entwickelt mit Egger-Lienz oder dem Nötscher Kreis. Anschließend verfolgten wir die expressive figurative Malerei nach 1945. Ich hatte damals einen guten Kontakt zu einem Künstler, den ich auch heute noch sehr schätze, Karl Stark, ein Klassiker in der figurativen Malerei. Dennoch sind wir stets für Pluralismus eingetreten und haben nie ein Scheuklappen-Denken verfolgt. Karl Stark war ebenso wie sein Freund Prof. Leopold ganz klar figurativ ausgerichtet, und alles Abstrakte war schrecklich für ihn. Umgekehrt gerierten sich die Vertreter der Abstraktion als die einzigen, wahren Künstler und lehnten figurative Malerei kategorisch ab: So malt man nicht! Das waren zwei verschiedene Welten. Wir sind dennoch immer neugierig gewesen, was es sonst noch gibt. Und so sind wir mit Georg Kargl in Kontakt gekommen, er hat dann die andere Welt eröffnet. Das erste Bild, das wir bei ihm erworben haben, war auch noch figurativ von „Muntean and Rosenblum“. Anschließend haben wir langsam zur abstrakten Malerei und Konzeptkunst, später auch zu Videokunst und Fotografie gefunden.“ Im Ergebnis ist die Sammlung als Sammlung österreichischer Künstler*innen gewachsen, parallel dazu gibt es Schwerpunkte von ausländischen Referenzpositionen. Heute sammeln Bernhard und Elisabeth Hainz ausschließlich zeitgenössische Kunst. „Ich tausche mich gerne mit Sammlern und vor allem auch mit Künstlern und Künstlerinnen aus. Zu 95 % greifen meine Frau und ich dann auf dasselbe.“ Das letzte Mal, als Bernhard Hainz wirklich längere Zeit zufrieden war, war unmittelbar nach der Anschaffung und Installierung des Werks von Lawrence Weiner für den offenen Treppenaufgang. Das Gefühl beschreibt er als „eine Phase, in der man verweilt und keine neuen Anliegen hat.“ Aber auch das ändert sich dann bei ihm wieder schnell. „Als Sammler ist man immer auf der Suche, das wird nur gemildert durch budgetäre Limits – insofern gibt es da einen Korrekturfaktor. Dan Graham ist beispielsweise ein toller Künstler, leider aber heutzutage kaum mehr erschwinglich.“
Zu den einzelnen Kunstwerken kann Hainz großartige Geschichten erzählen, sodass der Rundgang zu einem Erlebnis wird. Über Rudolf Polanszkys berühmtes „Großes Sitzbild“ weiß der Sammler aus sicherer Quelle, nämlich vom Künstler selbst, zu berichten, dass diese Mitte der 80er Jahre entstanden sind, als die „Neuen Wilden” die Szene aufmischten. Polanszky meinte in Bezug auf diese junge Bewegung: „So wie die malen, so male ich mit dem ‚Orsch‘.“ Und genau das hat er dann auch gemacht. Und zu Hans-Peter Profunsers Skulptur gibt es einen internen Gag: „Unter den Kolleginnen und Kollegen hier wird diese Skulptur auch als der geschundene Konzipient nach dem verlorenen Prozess interpretiert.“ Das ist in der Tat ein starkes Bild. Zur Arbeit von Lawrence Weiner merkt Hainz an, dass das Konzept des Künstlers jenes ist, dass die Kunst im Kopf entsteht, die muss gar nicht ausgeführt werden, sondern die Idee ist das Entscheidende. „Das war dann bei der Umsetzung hier doch etwas anders. Weiner war die Ästhetik der Anordnung schon ein Anliegen.“ Beim Skulpturen-Park im Foyer macht uns Hainz auf das Objekt von Bernhard Leitner aufmerksam, der 2015 den Staatspreis für Video- und Medienkunst erhielt und sich mit der Akustik und ihren vielfältigen sinnlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten beschäftigt. „Es geht um Laute, die man nicht nur hört, sondern auch spürt oder sieht. Er versucht die Schallwelle optisch sichtbar und so den Ton nicht nur akustisch erfahrbar zu machen. Diese Synchronisierung ist ein wesentlicher Aspekt seiner Kunst.“ Im Bereich der Papierarbeiten fasziniert das gefaltete Portrait von Samuel Beckett, eine Arbeit von Simon Schubert. Wir entdecken Klaus Mosettig. Er reproduziert Kunst mit anderen Medien, beispielsweise bringt er in einem Werk der Serie „Prado Lux” die Staubpartikel eines Dia-Projektors mit Bleistift auf Papier. Er empfindet auch Jackson Pollock oder eine Biedermeier-Studie nach. Die künstlerischen Positionen, denen wir begegnen, sind umfangreich. Darunter: Bruno Gironcoli, Sonja Leimer, Oswald Stimm, Walter Obholzer, Marcia Hafif, Nancy Haynes, Weiwei, Lei Xue, Erwin Bohatsch, Esther Stocker, Luisa Kasalicky, Gelatin, Carola Dertnig, Marina Sula, Johannes Rausch, Marc Adrian, Nedko Solakov, Gerwald Rockenschaub, Markus Huemer, Herbert Brandl, Thomas Reinhold, Heinrich Dunst, Judith Fegerl, Hans Kuppelwieser, Ahmed Oran, Markus Huemer, Rosemarie Trockel, Hans Schabus, Valie Export, Friederike Pezold, Arnulf Rainer, Hermann Nitsch, Franz West, Rudolf Schwarzkogler, Jonathan Meese, Christian Eisenberger, Heimo Zobernig, Markus Schinwald, Otto Muehl, Günter Brus, Martha Jungwirth, Franz Graf, Gabi Trinkaus, Tillman Kaiser, Svenja Deininger, Brigitte Kowanz, Joseph Beuys, Nil Yalter, Birgit Jürgenssen, Renate Bertlmann, Helga Philipp, Rita Nowak, Ashley Hans Scheierl, Jakob Lena Knebl, Peter Miller, Franz Grabmayr, Leander Kaiser, Martin Schnur, Francis Ruyter, Daniel Richter.
Auf die derzeitige Situation des „Restarts“ der Galerien und Ausstellungsräume nach dem Stillstand angesprochen, zeigt sich Hainz aus Sammlersicht zuversichtlich: „Tatsächlich hat die Covid- 19-Krise den Kunstmarkt 2020 massiv verändert, ich glaube aber nicht, dass er gänzlich zum Erliegen gekommen ist. Dies mag zwar während der strengen Beschränkungen im Frühjahr der Fall gewesen sein, nunmehr dürfte sich aber im Herbst doch wieder eine Renaissance des Kunstmarktes ereignen. Vor der Tür stehen die Eröffnungen von curated by in Wien, Ende September findet dann die viennacontemporary in der Marx Halle statt. Dort werden wir sicher vorbeischauen. Ehrlich gesagt waren wir über die Entschleunigung, die die Covid-19-Krise verursacht hat, gar nicht so unglücklich. Wir meiden zwar nach wie vor die Eröffnungen oder Abendessen, wo sich zahlreiche Menschen in geschlossenen Räumen zusammenfinden. Ich nutze aber die Gelegenheit, schon vor der Eröffnung oder danach allein in die Galerie zu gehen und habe auch in den letzten Monaten Kunstwerke erworben, beispielsweise die wunderbare 6‑teilige Fotoarbeit „Poem“ von Leonora De Barros (1979/2014) in der Galerie Kargl.“
Das Interesse für Kunst teilt Bernhard Hainz mittlerweile mit vielen Mitarbeiter*innen der Kanzlei, die sich freuen, wenn neue Werke dazukommen oder Kunstführungen angeboten werden. „Ich merke es an Diskussionen unter den Kolleg*innen, beispielsweise als ich das Gurkerl von Erwin Wurm gekauft habe. Es äußert sich auch ganz klar bei kunstaffinen Klienten, die sagen: Wir kommen lieber zu euch, weil bei euch gibt es gute Kunst. Da herrscht schon ein Austausch zwischen der Kunst und den Menschen, die diese Räumlichkeiten nutzen. Die Kunst gehört eigentlich schon zur Corporate Identity unserer Kanzlei.“ Als wir uns verabschieden und den Rundgang Revue passieren lassen, stellen wir fest, dass der eigentlich scherzhaft gemeinte Name „Contemporary Museum Schillerplatz“ durchaus seine Berechtigung hat.