Das ist keine Kunst. Das Todesurteil über die Arbeit kommt schnell, knapp und leidenschaftslos über so manch vorgeschobene Unterlippe. Ein kurzer Blick reicht und der Scheiterhaufen der Entwertung ist um ein Kunst-Stück reicher. Wie so oft in der Geschichte oder Gegenwart, zeichnen sich auch die Scharfrichter der Kunst nicht durch Kenntnisreichtum oder Fachkunde aus, sondern durch Arroganz. Jetzt darf man über solche Zeitgenoss:innen nicht zu hart urteilen, denn was als Arroganz bleibt ihnen denn noch, wo doch schon das Bewusstsein, das Interesse, die Selbstwahrnehmung, das Denken und die Reflexion fehlen? Arroganz ist das Einzige, was ihnen den Anschein einer Persönlichkeit verleiht und – mit entsprechender Attitüde zur Schau getragen – ihnen auch gewissen Respekt einbringt. Jedenfalls von denen, die auch keine Ahnung haben.
Finde ich scheiße, dagegen ist vollkommen in Ordnung. In der Subjektivierung liegt das Recht und die Freiheit, irgendwas gut, schlecht oder sonst wie zu finden und dem auch Ausdruck zu verleihen. Über Geschmack lässt sich nicht streiten und das ist auch gut so. Man kann sich einfach abwenden und den Blick lieber auf etwas richten, das positive Gefühle in einem auslöst. Damit wäre in beiden Fällen die Kunstbetrachtung abgeschlossen: Wahrnehmen, fühlen, urteilen, handeln. Das tun wir alle tausendmal am Tag. Wäre es anders, wären wir die ganze Zeit mit Denken beschäftigt und würden wahrscheinlich am Ende aussehen wie vergeistigte Gurus. Es kann lebenswichtig sein, schnell zu erfassen, einzuordnen und spontan zu reagieren, denn wer über den Sinn des (Weiter-)Lebens nachdenkt, während der Bus auf einen zukommt, dem bleibt höchstwahrscheinlich jeder weitere Gedanke erspart. Auf der anderen Seite haben wir wohl alle die eine oder andere Situation auf unserer Reue-Liste, in der man sich wünschte, vorher über etwas länger und/oder tiefer nachgedacht zu haben. Natürlich gibt es Bereiche, in denen das nicht angeraten ist, wenn man nicht suizidal werden will. Wer eindringlich über die großen Ks unserer Gesellschaft nachdenkt, wird Schwierigkeiten haben, danach sein komfortables Leben weiterzuführen. Kinder kriegen hat sich dann z. B erledigt.
Vermeintlich gefahrlos hingegen kann man über Kunst nachdenken. Das bietet sich an, denn wer Kunst in all seinen Formen betrachtet, hat meistens Zeit. Museums- und Galeriebesuche finden ja oft in Mußezeiten statt und laden daher zu mehr ein als zu dem Viersprung aus Wahrnehmen, Fühlen, Urteilen und Handeln. Für Denksportler:innen bietet sich der geistige Sechskampf an: Wahrnehmen. Unterscheidet sich von der Wahrnehmung der Vierspringer ggf. nur durch die Intensität und Dauer.
Fühlen. Das ist schnell, schneller als das Licht. Wir fühlen, bevor wir denken, daran ist nichts zu ändern. Da das Fühlen nichts mit Denken, aber viel mit dem Unbewussten, der persönlichen Geschichte und Neurosen zu tun hat, ist es dem präventiven Zugriff durch unser Bewusstsein entzogen. Der geübte Geist registriert das Gefühlte und versucht, es ins Licht der Selbstwahrnehmung zu stellen. Naturgemäß ist das nicht immer angenehm, denn besonders die unschönen Gefühle wie Selbsthass, Neid, Angst oder Wut hat man ja eigentlich nicht. Wieso, zur Hölle, ruft dann dieses Kunstwerk ausgerechnet so ein Gefühl hervor? Woher kommt meine Abneigung, die man so gesehen wohl Abwehr nennen muss? Sieht mein Auge vielleicht etwas, das ich selbst nie imstande wäre, zu schaffen und höre ich meinen Mann sprechen, der schon immer der Meinung war, ich hätte lieber den Friseursalon meiner Mutter übernehmen sollen? Macht meine eigene Lebensbilanz mich so wütend? Kommt die Beklemmung beim Betrachten aus meiner Erinnerung oder aus meinem Drang, mich endlich von was auch immer zu befreien? Muss ich die Arbeit abwerten, weil ich die Künstlerin kenne und ihr außer ihrer Freiheit nicht auch noch den Erfolg gönne? Oder aber basiert mein negatives Gefühl auf einer fachlichen Einschätzung? Schon tausendmal gesehen und fast immer besser? In jedem Fall kommt es beim Sechskampf an dieser Stelle zu einer reflektierten Betrachtung des eigenen emotionalen Empfindens, selbst wenn die ultimative Selbsterkenntnis ausbleiben sollte.
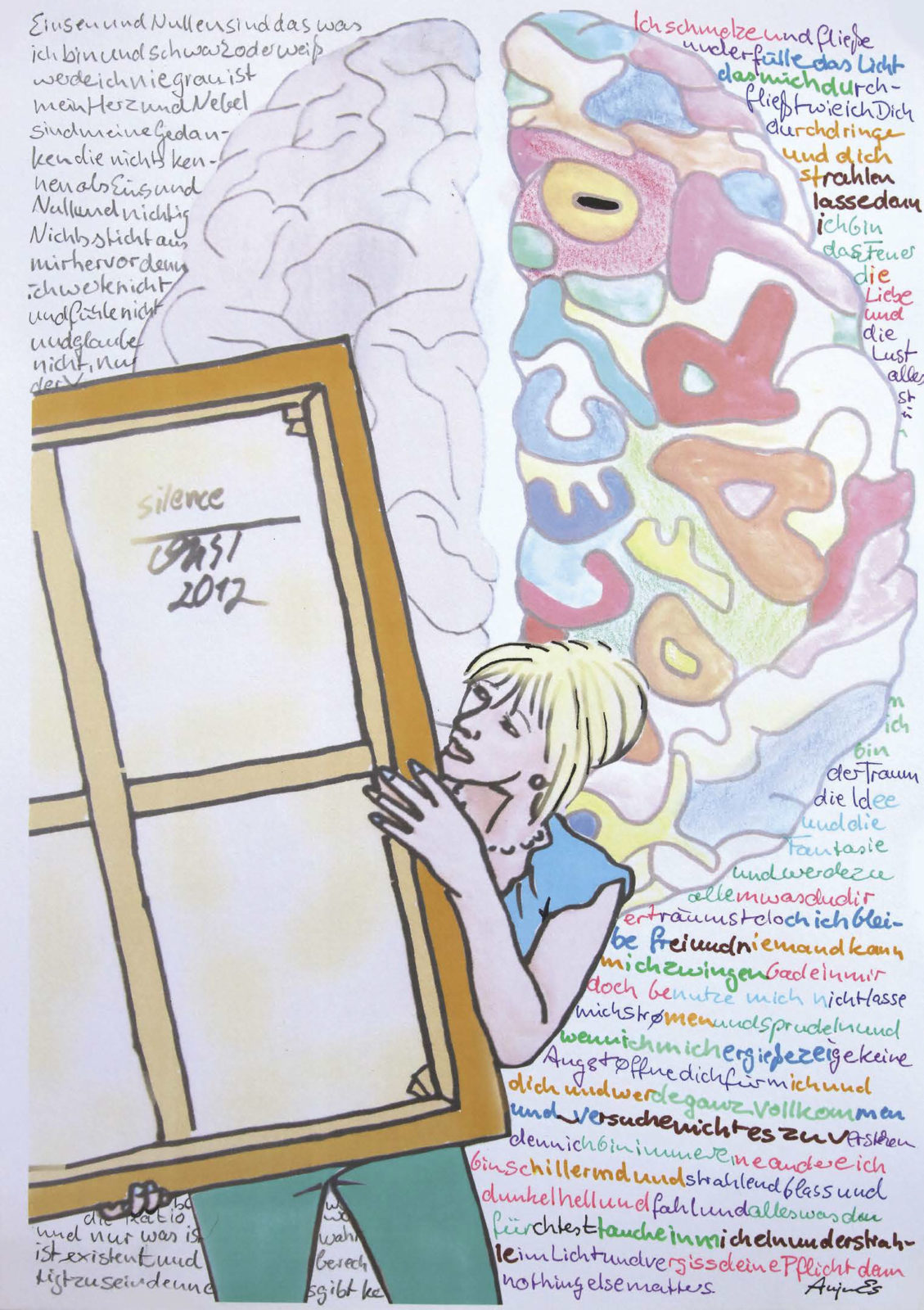
Erst jetzt unter Berücksichtigung der eigenen Subjektivität, die übrigens bestenfalls mit der Fähigkeit sich selbst gegenüber nachsichtig und gütig zu sein, einhergeht, kommt der kognitive Teil, also das eigentliche Denken. Beim Denken kann Bildung nicht schaden und da haben es Leute mit entsprechender zerebraler Hard- und Software natürlich einfacher. Aber auch ohne Ahnung kann man Fragen stellen und manchmal Antworten finden und wie beim Sport führt Training zu besserer (Denk)Leistung. Eine Schinderei ist es dennoch manchmal, weshalb ich des Öfteren auf ein profundes Halbwissen zurückgreife – und dabei auf den Großmut meiner Mitmenschen setze.
Kunsttheoretisches oder kunsthistorisches Wissen, ja Wissen allgemein vereinfacht den Zugang zur Kunst ungemein. Beim Konsum von Musik ist uns das schon lange in Fleisch und Blut übergegangen. Meistens können wir einordnen, welche Art von Musik wir hören, wir kennen die Interpret:innen und wissen oft relativ viel über die Band, die Zeit, in der die Musik entstanden und auf welchem gesellschaftlichen Mist sie gewachsen ist. Im Kontext aller Gegebenheiten erscheint uns Musik in einem anderen, lebendigeren Licht, als wenn wir sie ohne Wissen anhören würden – Ist mit Kunst nicht anders. Nach dem Fertigdenken kommt das Abwägen auf dem Hintergrund von Ethik, Moral, Fakten und Geist und erst daraus kann sowas wie Haltung entstehen, die es wert ist, geäußert zu werden – und zwar nach wie vor als persönliches Statement, denn mit Objektivierung hat weder die beste Selbstreflexion noch das umfassendste Wissen zu tun. Natürlich macht es viel mehr Spaß, die gewonnene Haltung als glorifizierende Begeisterungssalve auf den gefeierten Künstler oder die göttliche Diva abzufeuern oder als ätzenden Verriss eines miesen Machwerks, das das Licht beschmutzt, das es bescheint. Aber dann wäre die ganze Denkerei im Vorwege ja Perlen vor die Säue.
Reflexion ist keine Einbahnstraße, weshalb nicht nur die Betrachter bemüßigt sind, sich und die präsentierte Arbeit zu hinterfragen, sondern auch für die Erschaffer:innen von Kunst selbst ist sie eine Option. Option deshalb, weil Kunst auch ohne reflektierten Schöpfungsprozess Kunst bleibt. Dennoch sind gesellschaftspolitisches Bewusstsein und eine geschulte Selbstwahrnehmung beim künstlerischen Arbeiten ein Qualitätsmerkmal, das dem Werk eine andere Tiefe geben kann, ihr manchmal Bedeutung verleiht, die über das Ästhetische weit hinaus geht. Künstler: innen dazu moralisch zu verpflichten, widerspricht dem Freiheitsprinzip der Kunst, die alles darf und nichts muss.
Halt … ist das so? Der Skandal der Documenta Fifteen lässt daran zweifeln und setzt der Kunst Grenzen. Kritiker:innen sehen hier sowohl einen eklatanten Mangel an Reflexion der Künstler, die hätten wissen müssen, was ihre Arbeiten auf dem gesellschaftlichen und historischen Hintergrund auslösen würden, als auch an der Reflexion der Macher:innen, die offenbar ziemlich unreflektiert gezeigt haben, was ihnen passend schien. Das war ein Fauxpas ohne Zweifel und unentschuldbar. Es stellt sich (jedenfalls mir) jedoch die Frage, inwiefern sich die Bewertung dieser Entscheidung verändern würde, hätte der Präsentation ein reflektierter und bewusster Entschluss zugrunde gelegen – ein gezielter Tabubruch der schlimmsten Art. Vermutlich hätte man sich schon aus ethisch-moralischen Gründen dagegen entschieden, aber eine solche Entscheidung hätte deutlich gemacht, dass die Documenta mehr ist als nur die Glitzershow der aktuellen Kunst. Vereinzelt wäre vielleicht der Vorwurf der Selbstzensur zu hören gewesen, aber die Gewichtung von Zensur auf der einen Seite und der Würde des Menschen auf der anderen sollte klar sein.
Schließen wir mit einem versöhnlichen Blick in den Spiegel, der übrigens nie zeigt, wie wir aussehen, sondern uns mit unserem Spiegelbild abspeist. Wie auch immer wir in ihn hineinschauen – er schaut ebenso auf uns. Schenken wir ihm ein albernes Lächeln und denken einen Moment lang nicht darüber nach, was so lustig sein soll.


